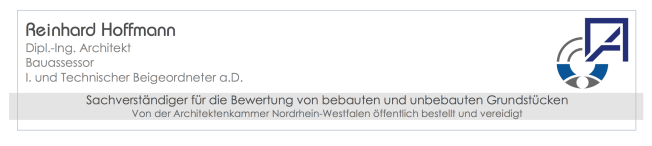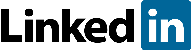Zwangsversteigerung
Was ist eine Zwangsversteigerung?
Auftraggeber: Rechtspfleger der Amtsgerichte als Vollstreckungsgerichte
Zwangsversteigerung ist die gerichtliche Durchsetzung eines finanziellen Anspruchs. Dabei hat ein Gläubiger die Möglichkeit, seine finanziellen Forderungen beim Schuldner an dessen Grundstück, Teileigentum oder grundstücksgleichen Rechten zu vollstrecken um seine Ansprüche zu befriedigen. Für die Aufhebung der Eigentümergemeinschaft gilt die Teilungsversteigerung als besondere Form der Zwangsversteigerung.
Mit der Zwangsversteigerung ist durch Ersteigerung eines Dritten der Verlust der Eigentümerschaft für den Eigentümer verbunden.
Wie läuft das Verfahren der Zwangsversteigerung ab?
Rechtgrundlage des Zwangsversteigerungsverfahrens ist das Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung – ZVG.
Das Zwangsversteigerungsverfahren wird bei dem Amtsgericht durchgeführt, in dessen Bezirk die Immobilie liegt.
Die Zwangsversteigerung muss durch einen Gläubiger beantragt werden, der Eigentümer eines im Grundbuch dinglich gesicherten Rechts ist oder eine Geldforderung an den Schuldner hat. Nach Prüfung, ob der Antrag ordnungsgemäß ist und die formalen Voraussetzungen für die Anordnung der Zwangsversteigerung vorliegen, beschließt der Rechtspfleger des Amtsgerichts die Anordnung des Verfahrens und teilt dieses dem antragstellenden Gläubiger und dem Schuldner mit und vermerkt im Grundbuch, dass die Zwangsversteigerung angeordnet ist.
Hiergegen kann der Schuldner sofortige Beschwerde beim Landgericht stellen. Des Weiteren hat er die Möglichkeit, zu beantragen, das Verfahren auf Dauer von höchstens 6 Monaten einzustellen, wenn Aussicht besteht, dass der Schuldner nachweisen kann, dass er den Forderungen des Gläubigers nachkommen und durch die Einstellung die Versteigerung vermieden werden kann oder wenn mit der Versteigerung eine sittenwidrige Härte verbunden wäre.
Vor dem Zwangsversteigerungstermin muss das vollstreckende Amtsgericht den Verkehrswert des Versteigerungsobjekts festsetzen. Hierzu bedient es sich in der Regel eines öffentlich bestellten Sachverständigen für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Der Versteigerungstermin ist öffentlich. Bieter müssen unmittelbar nach Abgabe des Gebots Sicherheitsleistungen z.B. in Form von Bankbürgschaftserklärungen in Höhe von 10 % des Verkehrswerts vorlegen.
Gläubiger, die das Verfahren beantragt haben, können bis zur Verkündung des Zuschlages unabhängig von dessen Höhe die Einstellung des Verfahrens bewilligen. Bleibt das abgegebene Meistgebot unter 7/10 des Verkehrswerts, kann ein Berechtigter, dessen Anspruch durch das Meistgebot nicht gedeckt ist, die Versagung des Zuschlages beantragen. Dem kann der beantragende Gläubiger widersprechen, wenn er glaubhaft macht, dass ihm durch die Versagung des Zuschlages ein unverhältnismäßiger Nachteil erwachsen würde. Liegt das Meistgebot beim ersten Versteigerungstermin unter 5/10 des Verkehrswerts ist der Zuschlag von Amts wegen zu versagen. Bei weiteren Versteigerungsterminen gilt diese Grenze nicht mehr.
Mit dem Zuschlag wird der Meistbietende Eigentümer des Grundstücks und seiner wesentlichen Bestandteile. Minutengenau gehen alle Gefahren eines Untergangs des Grundstücks nebst seinen wesentlichen Bestandteilen und dessen Zubehör sowie alle Lasten, auch unbekannte, sowie die Haftpflichtversicherung minutengenau auf den Ersteher über. Schuldrechtliche Rechte und Pflichten gehen mit der Zwangsversteigerung unter. Zeitgleich stehen ihm die Nutzung und die Fruchtziehung zu.
Nach dem Zuschlag bestimmt der Rechtspfleger einen Verteilungstermin, bei dem der Ersteigerungserlös abzüglich der Verfahrenskosten nach der im Grundbuch vorgegebenen Rangfolge den Gläubigern zugeteilt wird. Falls Überschüsse verbleiben, stehen diese dem Schuldner zu. Spätesten bis zu diesem Termin muss der Ersteher das Meistgebot zuzüglich 4 % Zinsen ab Zuschlagstermin abzüglich hinterlegter Sicherheiten auf das Gerichtskonto einzahlen.
Anschließend und sobald die Zahlung der Grunderwerbsteuer durch Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes nachgewiesen wurde, wird vom Grundbuchamt auf Antrag des Versteigerungsgerichts das Grundbuch durch Eintragung des neuen Eigentümers berichtigt.
Lohnt es sich, eine Immobilie zu ersteigern?
Oft werden Immobilien in einer Zwangsversteigerung deutlich unter Verkehrswert versteigert. Der Median des Meistgebots im Verhältnis zum Verkehrswert liegt nach einer Untersuchung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz aus dem September 2017 bundesweit bei 74,16 %. Doch Vorsicht – dies ist sowohl objekt- als auch lageabhängig. So liegt der Median beim Amtsgericht Köln bei 98,65 % und beim Amtsgericht Essen bei 61,53 %. Eine attraktive Villa an einem guten Standort kann auch oberhalb des Verkehrswerts versteigert werden, während ein Wohnhaus im ländlichen Raum möglicher Weise als Schnäppchen den Eigentümer wechselt.
Einem Immobilieneigentümer, dem eine Zwangsversteigerung droht, sei daher geraten, sich rechtzeitig durch freihändige Veräußerung von seiner Immobilie zu trennen. Er verliert durch die Zwangsversteigerung nicht nur seine Immobilie mit einem deutlichen Wertverlust, sondern muss sich auch noch die Verfahrenskosten anlasten lassen.
Für einen Interessierten ist es dagegen eine Chance, günstig an eine Immobilie zu kommen. Jedem Interessenten sei aber geraten, vor seinem Gebot genau zu prüfen, ob es sich bei der beabsichtigten Ersteigerung wirklich um eine gute Chance handelt, günstig unter Verkehrswert zu einer Immobilie zu kommen oder ob er sich auf ein nicht erkanntes Risiko einlässt. Ein Zurück gibt es nach dem Zuschlag durch den Rechtspfleger des Amtsgerichts nicht mehr.
Eine Übersicht über die anstehenden Zwangsversteigerungstermine bietet das Zwangsversteigerungsportal der Justizverwaltungen.
Warum ist eine gewissenhafte Bewertung der Immobilien bei einer Zwangsversteigerung besonders wichtig?
Bei einer Zwangsversteigerung sind die genaue Bewertung und Beschreibung einer Immobilie besonders wichtig, weil der Erwerber in der Regel im Versteigerungsverfahren ausschließlich durch das Verkehrswertgutachten Informationen über das Objekt erfährt. Eine verantwortungsvolle ausführliche Beschreibung des Grundstücks und seinen wesentlichen Bestandteilen insbesondere des Gebäudes, Bewertung aller wertrelevanten Faktoren einschließlich des Zustandes, der Schäden des Versteigerungsobjektes, sowie der wertrelevanten Rechte und Belastungen sind dabei von großer Bedeutung. Im Idealfall ist ein Verkehrswertgutachten so detailliert beschrieben und bebildert, dass ein potentieller Bieter nach sorgfältigem Studium blind durch das Haus gehen könnte und sich zurechtfinden würde. Er kennt dann die Qualität der Raumfunktionen untereinander, die Gebäudeausstattung und weiß um seine Mängel.
Aber – der Eigentümer muss einen Sachverständigen nicht zur Objektbesichtigung in sein Haus lassen. Dann bleibt dem Gutachter nur noch die Möglichkeit, Grundstück und Gebäude von außen zu bewerten, was natürlich mit einem hohen Wertrisiko verbunden ist. Das Haus könnte innen völlig verwohnt, voller Mängel, nur unvollständig ausgebaut oder zumindest teilweise baurechtswidrig gebaut oder verändert sein. Diese Risiken werden oft mit einem Wertabschlag von bis zu 30 % gewürdigt.
Bei einem Ertragswertobjekt ist mitentscheidend, ob bei einem Renditeobjekt der derzeitig gezahlte Mietzins auch in der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer nachhaltig erzielt werden kann.
Welchen Einfluss hat die Versteigerung des Erbbaurechts auf den der Erbbauzins?
Es können sowohl Erbbaugrundstücke als auch Erbbaurechte versteigert werden.
Der Erbbauzins wird dinglich in Abteilung II des Grundbuchs gesichert und lastet als Reallast auf dem Erbbaurecht. Er muss aber nicht an erster Stelle in der Rangfolge im Erbbaugrundbuch stehen, sondern kann auch hinter anderen Belastungen im Rang nachstehen.
Wenn die Zwangsversteigerung eines Erbbaurechts von einem Gläubiger ausgeht, der dem Rang des Erbbauzinses nachsteht, muss der Ersteher den Erbbauzins übernehmen, weil die Reallast bestehen bleibt. Wenn aber ein Gläubiger, dessen Forderungen im Rang dem Erbbauzins vorgehen oder gleichstehen, bei älteren Erbbaurechten die Versteigerung betreibt, kann die Erbbauzinsreallast untergehen, wenn keine Zwangsversteigerungsfestigkeit besteht.
Damit würde der Eigentümer des Erbbaugrundstücks keinen Erbbauzins mehr für die restliche Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages erhalten, da eine Erbbauzinsreallast nicht versteigerungsfest ist – eine Katastrophe für den Eigentümer des Erbbaugrundstücks!
Erst seit dem 01.10.1994 kann als Inhalt des Erbbaurechts vereinbart werden, dass die Erbbauzinsreallast einschließlich einer Wertsicherungsklausel in der Zwangsversteigerung des Erbbaurechts nicht untergehen kann, wenn sie dem Recht des betreibenden Gläubigers in der Rangfolge nachsteht. Eine Zwangsversteigerungsfestigkeit der Erbbauzinsreallast kann und sollte also aufgrund dieser Regelung grundsätzlich vereinbart werden.
Nachträglich kann die Zwangsversteigerungsfestigkeit als Inhalt des Erbbaurechts auch vereinbart werden. Voraussetzung für die Wirksamkeit dieser Vereinbarung ist aber, dass alle Inhaber vorangehender oder gleichrangiger Rechte zustimmen.