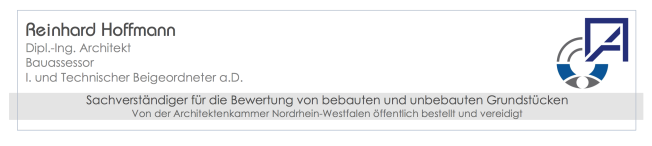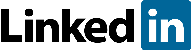Praxisbeispiel
Das unter Denkmalschutz stehende Ackerbürgerhaus aus 1856 ist in den achtziger Jahren kernsaniert worden. Seinerzeit wurden die Fachwerkaußenwände innen mit 8 - 10 cm und die Giebelseite außen unter der Verschieferung mit 12 cm Mineralwolle gedämmt. Der Anbau hat außen ein 8 cm dickes Wärmedämmverbundsystem. Bei den außen gedämmten Wänden wurde der 3 cm tiefe Zwischenraum der Hinterkonstruktion für die Fermacellplatten noch mit Mineralfaserplatten gefüllt. Die Dachfläche wurde mit 15 cm Mineralwolle zwischen und unter den Sparren gedämmt und unter der erdgeschossigen Fußbodenheizung liegt eine 8 cm dicke Wärmedämm- und Trittschallschicht aus Styrodur und Mineralwolleplatten. Die Fenster bestehen aus einem Holzsprossenverbundsystem. Das Deelentor ist mit 4 cm Mineralwolle gedämmt.
Das Gebäude wurde bis 2024 mit einer Niedertemperatur-Gasheizung aus 1986 beheizt. Ein Kaminofen mit Wassertaschen war in das System eingebunden. Brauchwasser wurde in einem 300 l Boiler erwärmt. Das Erdgeschoss wird mit einer Kupferrohr-Fußbodenheizung über den 1. Heizkreislauf erwärmt. An den 2. Heizkreislauf im Obergeschoss sind Konvektionsheizkörper und in den Bädern in den Rücklauf der Handtuchwärmer eine Kupferrohr-Fußbodenheizung angeschlossen.
Der Energieverbrauch lag in den 10 Jahren von 2014 bis 2023 in einer Spanne von 21.302 kWh bis 39.227 kWh durchschnittlich bei 28.670 kWh im Jahr. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kinder-, Gäste- und Schlafzimmer im Obergeschoss nur noch eingeschränkt beheizt waren. Das führt in einem Energieausweis auf Verbrauchsbasis zu einem Endenergiebedarf von circa 150 kWh/m²*a beziehungsweise einer Energieeffizienzklasse E.
Nach Einbau der Wärmepumpe 2024 wurde die Heizungsvorlauftemperatur bei der Heizkurve mit 38,5° C bei einer Normaußentemperatur von -11,3° C so eingestellt, dass das Wohnbereich im Erdgeschoss mit etwa 21° C ausrechend warm wird. Aus Effizienzgründen erhält auch der 2. Heizkreislauf keine höhere Vorlauftemperatur. Aufgrund der Fußbodenheizung werden die Bäder ebenfalls 21°C warm. Bei den übrigen Räumen werden im Winter die 16 - 17° C Innentemperatur wie bisher, auch akzeptiert, weil es sich hier überwiegend um Schlaf-, Gäste- und zur Zeit nicht mehr genutzte Kinderzimmer handelt. Sollten diese Räume zu einem späteren Zeitpunkt vollwertig als Wohnräume mit 21° Innentemperatur genutzt werden, müssen die Konvektionsheizkörper gegen etwas größere Tieftemperatur-Heizkörper mit integrierter Konvektion ausgetauscht werden, die ebenfalls mit einer Vorlauftemperatur von 35° C die Räume ausreichend warm machen können.
Über den in den 80-er Jahren gewählten Standard hinaus sind keine energetischen Verbesserungen der Gebäudebauteile durchgeführt worden. Eine energetische Sanierung Richtung GEG - Gebäudeenergiegesetz ist wirtschaftlich nicht zu vertreten. Gleichwohl wird das Gebäude allein durch die energetische Sanierung mit Wärmepumpe und Fotovoltaikanlage zu einem bilanziellen Plus-Energiehaus und zwar einschließlich Haushaltsstrom und Elektromobilität.
Das unten angeführte Beispiel erfasst die ersten 12 Monate nach Inbetriebnahme von Wärmepumpe und Fotovoltaikanlage im Zeitraum vom 16. Juli 2024 bis zum 15. Juli 2025.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Stromverbrauch für die Wärmepumpe sowie der Fotovoltaikertrag bezüglich Eigenverbrauch und Einspeisevergütung wetterbedingt jährlich starken Schwankungen unterworfen sein können.
Das Beispiel zeigt aber, dass es möglich ist, ein Bestandsgebäude bei mittlerem Dämmstandard mit einer Wärmepumpe und Fotovoltaikanlage sinnvoll energetisch zu sanieren. Dabei sollten folgende Grundsätze beachtet werden:
- Ertüchtigung der Gebäudehülle gegebenenfalls soweit, dass maximal 55° Vorlauftemperatur ausreichen, um die Räume auf angenehme Wohnraumtemperatur beheizen zu können. Bei einem Energiebedarf von circa 150-180 kWh/m² Wohnfläche (ca. 15 - 18 l Heizöl) dürfte das gelingen. Der Einbau einer Flächenheizung oder alternativ der Austausch der bestehenden Heizkörper gegen Niedertemperaturheizkörper ist dabei zu prüfen.
- Auswahl der Wärmepumpe mit einer hohen Effizienz (ETAs > 225 bei VL 35° / ETAs > 175 bei VL 55°). Am Markt werden Wärmepumpen mit einem Effizienzunterschied von bis zu 40 % angeboten. (siehe Bafa Liste der förderfähigen Wärmepumpen)
- Erneuerung des hydraulischen Systems (Schichtenspeicher) mit einer hohen Schichtungseffizienz. Die Effizienzunterschiede gegenüber einem üblichen Pufferspeicher mit Frischwassermodul können auch hier bis zu 40 % betragen. (Ranking der Fachhochschule Rapperswil)
- Absenkung der Vorlauftemperatur so weit wie möglich. Laut Werbung können moderne Wärmepumpen auch 70° Vorlauftemperatur erzeugen, dieses ist aber höchst ineffizient. Der Effizienzunterschied zwischen 35° und 55° Vorlauftemperatur beträgt ebenfalls circa 30 %.
- Die Ergänzung der Wärmepumpe durch eine Fotovoltaikanlage mit einem leistungsstarken Batteriespeicher kann nur empfohlen werden, da das Einsparungspotenzial damit noch einmal deutlich gesteigert werden kann.
- Dann macht auch das Fahren mit einem Elektroauto Freude!
- Unter der Annahme, dass gegenüber dem vorgenannten Beispiel eine Wärmepumpe mit einer 30% geringeren Effizienz, ein hydraulisches Speichersystem mit einer ebenfalls 30% geringeren Effizienz und eine Vorlauftemperatur von 55° gewählt werden, ergibt sich folgender Effizienzunterschied: 0,70 × 0,70 × 0,70 = 0,34. Das heißt, die Energiekosten sind dann dreimal so hoch.
In der bisherigen Hochrechnung kann von einer Amortisationszeit von 14-15 Jahren ausgegangen werden.
Detailinformationen können im Folgenden den Monitoringdaten der Wärmepumpe Lambda EU15L vom 16. Juli 2024 bis zum 15. Juli 2025 entnommen werden.
Der Gaskostenvergleich berücksichtigt eine Gas-Brennwertheizung mit einem Systemverlust von 6 %.